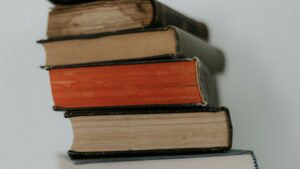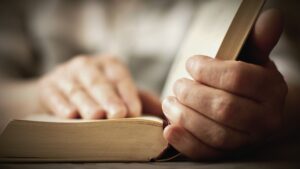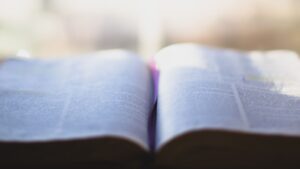Vorteile sichern
Wissen zur Bibel
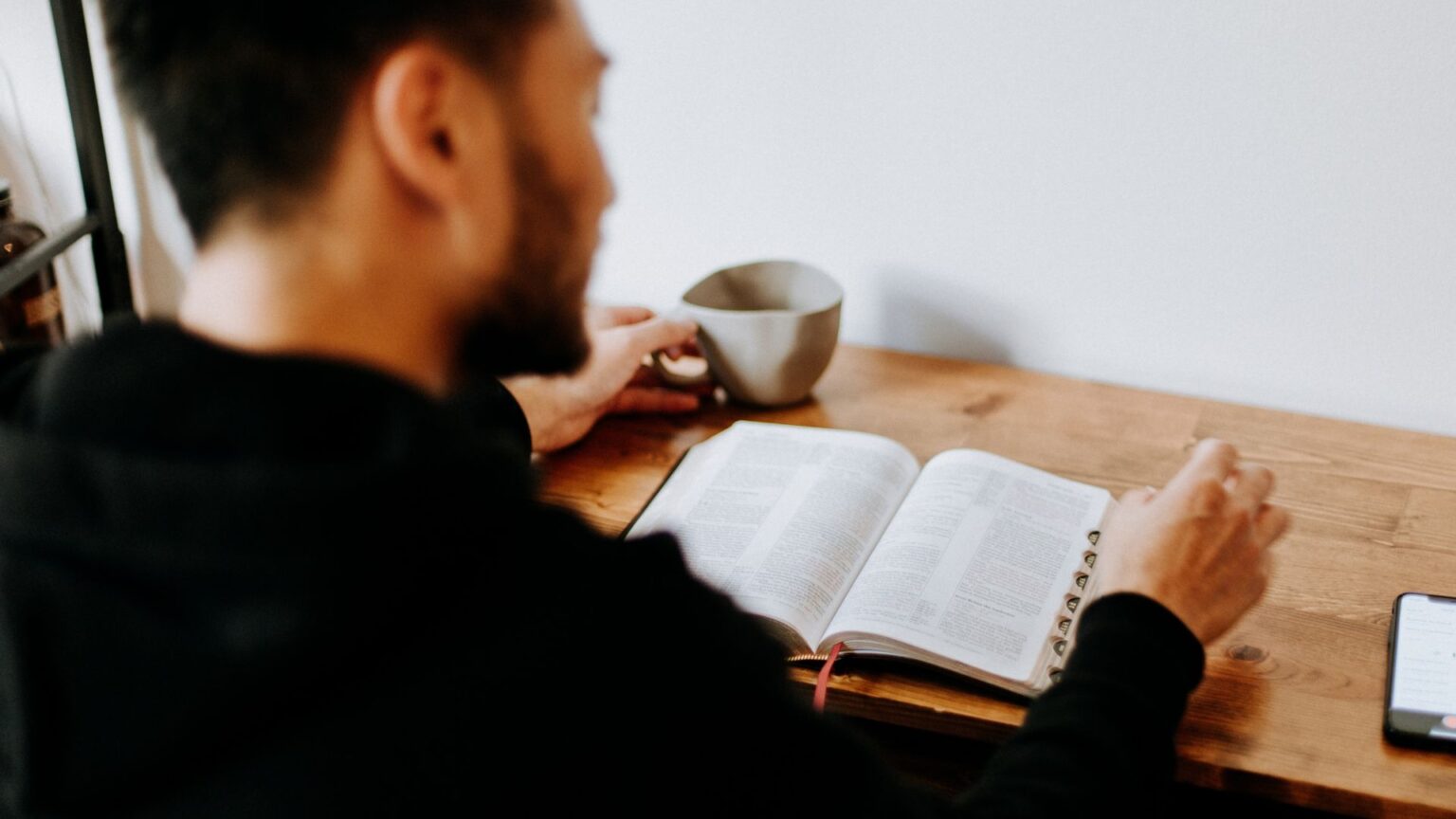
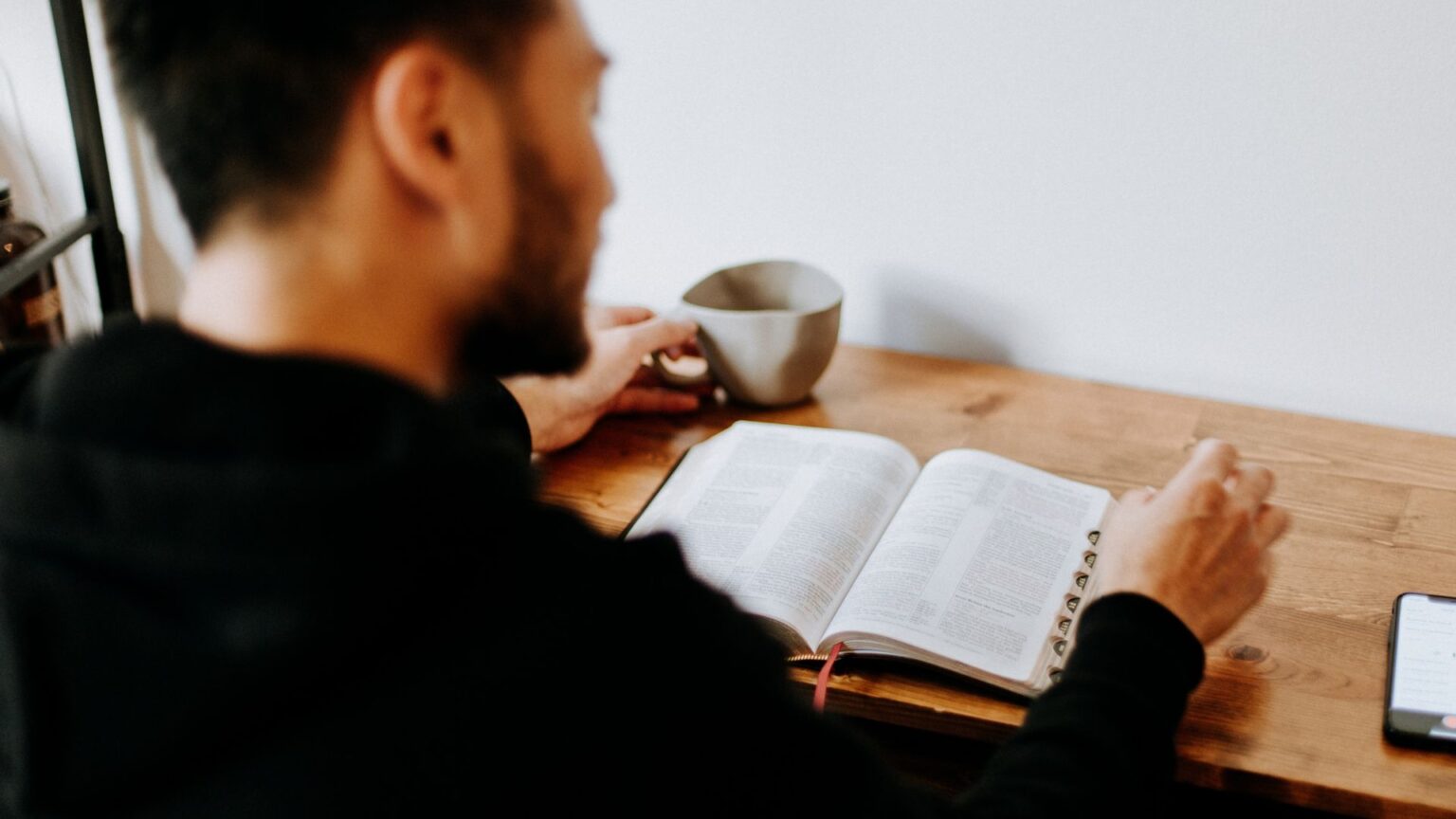
Worum geht es in der Bibel? Und wie finde ich mich in diesem dicken Buch zurecht? Auf diesen Seiten finden Sie umfangreiche Informationen zu allem, was man über die Bibel wissen sollte.
Die Bibel ist eigentlich eine ganze Bibliothek. In ihr sind verschiedene Einzelschriften, Erzählungen, Gebete, Lieder, Reiseberichte und Briefe gesammelt. Viele Themen sind dabei nach wie vor aktuell, auch wenn sie vor mehreren tausend Jahren aufgeschrieben wurden. Kenntnisse über die Entstehung der Bibel hilft uns sie besser zu verstehen und uns in diesem dicken Buch zurecht zu finden.